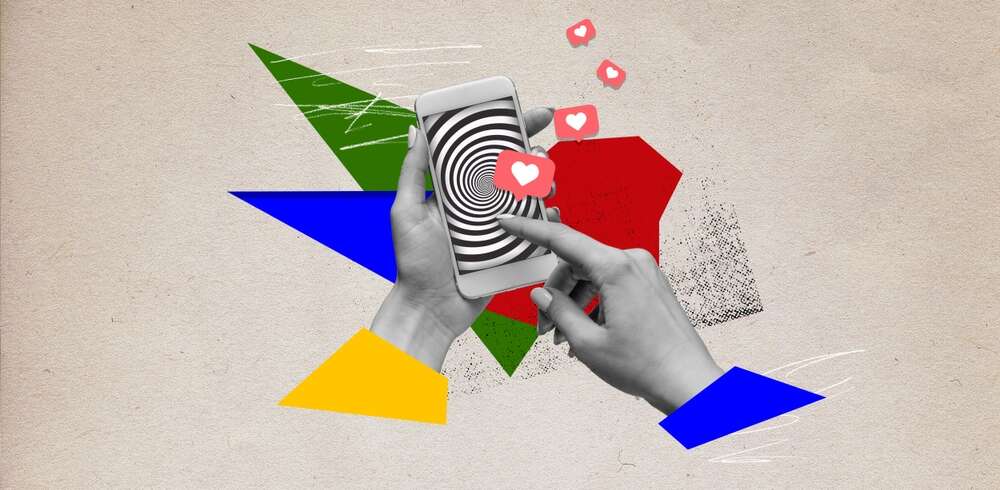Die digitale Transformation hat die Medienlandschaft grundlegend verändert, Heterogenität und Hybridität bestimmen die Medienbotschaften. Neben klassischen Nachrichtenmedien prägen heute Social-Media-Influencer und nicht-journalistische Quellen zunehmend die öffentliche Meinungsbildung. In einem solchen ‘High-Choice Media Environment’ zwischen zahllosen Informationsangeboten, verschwimmen die Grenzen zwischen klassischem Journalismus, Influencer-Content und anderen Informationsquellen zusehends.
Wie gehen Menschen damit um? Eine gemeinsame Studie des rheingold Instituts und des Instituts für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist dem Umgang der Nutzenden mit der neuen Medienvielfalt auf den Grund gegangen. Die Forschungsarbeit wurde jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft mit dem ersten Platz für den besten kommunikationswissenschaftlichen Zeitschriftenaufsatz 2024 ausgezeichnet.
Tiefenpsychologische Analyse deckt neue Mechanismen auf
Wie gehen Menschen mit der neuen medialen Komplexität um? Welche psychologischen Mechanismen bestimmen ihre Informationsauswahl und Meinungsbildung? Diesen Fragen sind wir in 32 tiefenpsychologischen Einzelexplorationen nachgegangen. Die von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien geförderte Studie hat die Nutzung der vielfältigen Informationsangebote tiefgreifend untersucht und dabei insbesondere konkrete Nutzungsmomente exploriert und die Auswirkungen der neuen Nutzungsmuster auf die Meinungsbilder analysiert.
Mediennutzung als psychologische “Selbstbehandlung”
Ausgangspunkt der Forschung war die Annahme, dass Mediennutzung immer auch der psychologischen “Selbstbehandlung” dient . Menschen suchen in Medien nicht nur Informationen, sondern auch Orientierung, Bestätigung und emotionale Resonanz. In der aktuellen, hochkomplexen Medienumgebung wird das zur besonderen Herausforderung , da ihnen die Informationen in nie gekannter Fülle ‚zufliegen‘ und von daher Qualität und Vertrauenswürdigkeit immer schwerer zu überprüfen sind. Was heißt das für die Meinungsbildung und gefährdet diese Entwicklung die Demokratie?
Sechs Typen der Meinungsbildung identifiziert
Unsere Analyse identifizierte zwei zentrale Spannungsfelder: Zum einen das Verhältnis zwischen aktiver und passiver Meinungsbildung, zum anderen die Balance zwischen Meinungsstärke und Meinungsflexibilität. In diesem psychologischen Wirkungsraum konnten wir sechs distinkte Meinungsbildungstypen identifizieren, die jeweils eigene Strategien im Umgang mit der Informationsflut entwickelt haben und über jeweils eigene Ausrichtungen in der Meinungsbildung verfügen.
Gefühl schlägt Qualität: Neue Bewertungskriterien dominieren
Besonders interessant: Die Bewertung von Informationsquellen folgt dabei weniger rationalen Qualitätskriterien als vielmehr einem Mix aus funktionalen und affektiven Faktoren. Typenübergreifend zeigen sich zwei zentrale Kriterien: die wahrgenommene Glaubwürdigkeit der Quelle und die Übereinstimmung mit eigenen Überzeugungen. Diese Muster finden sich sowohl bei der Nutzung klassischer Medien als auch bei der Rezeption von Influencer-Content oder nicht-journalistischen Quellen.
Information Overload führt zu oberflächlicher Verarbeitung
Die Studie zeigt auch: Die heterogene und hybride Fülle an verfügbaren Informationen überfordert viele Menschen. Statt sich intensiv mit Inhalten auseinanderzusetzen, verlassen sich viele auf schnelle Faustregeln und Heuristiken. Diese ermöglichen zwar schnelle Urteile, führen aber oft zu weniger stabilen Meinungen und können die Entstehung von Echokammern begünstigen.
Ausblick: Quantitative Validierung folgt
Diese Erkenntnisse haben weitreichende Implikationen für die demokratische Meinungsbildung. Um die praktische Relevanz unserer Forschung zu vertiefen, haben wir, im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, die unterschiedlichen Typen quantifiziert. Die Ergebnisse, die im Mai 2025 veröffentlicht werden, sollen konkrete Handlungsempfehlungen für Medien, Politik und Bildungseinrichtungen liefern.
Mediennutzung entscheidend für die Zukunft demokratischer Diskurse
Die Auszeichnung unserer Forschungsarbeit bestätigt: Die Digitalisierung hat nicht nur die Medienlandschaft verändert, sondern auch die Art und Weise, wie Menschen sich ihre Meinung bilden. Das Verständnis dieser neuen Mechanismen ist entscheidend für die Zukunft demokratischer Diskurse. Nur wenn wir die psychologischen Prozesse der modernen Meinungsbildung verstehen, können wir konstruktive Wege finden, qualitativ hochwertige Informationen auch in der digitalen Informationsflut wirksam zu vermitteln.
Der Zeitschriftenaufsatz ist 2024 in Medien & Kommunikationswissenschaft erschienen.
Hier geht es zum preisgekrönten Aufsatz von Birgit Stark, Daniel Stegmann, Pascal Schneiders und dem rheingold Psychologen Sebastian Buggert